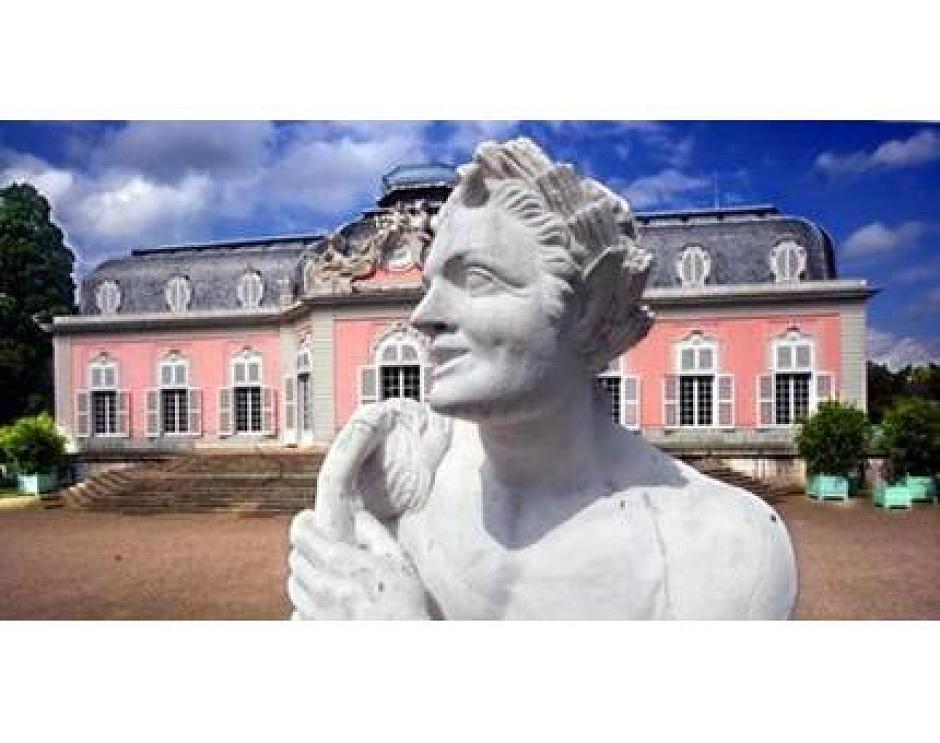Sie bestimmen, was morgen an Klamotten angesagt ist: Modedesigner.
Sabrina macht ein Praktikum in der Branche und entwirft sogar schon
eigene Stücke. Jetzt träumt sie von einer Anstellung.
Modedesignerin werden. Das war schon Sabrinas Kindheitstraum. Doch wie wird man Modedesignerin? Beste Voraussetzungen hat, wer Abitur und ein abgeschlossenes Studium hat. Ganze fünf Jahre muss man an einer staatlichen Uni studieren oder drei Jahre an einer privaten. Auch Praktika helfen, im Beruf Fuß zu fassen.
Sabrina absolviert seit August ein halbjähriges Praktikum bei C&A. Das Unternehmen sitzt in einem riesengroßen Gebäude in Düsseldorf am Flughafen. Im Gebäude gibt es verschiedene Etagen mit unterschiedlichen Aufgabenbereichen. In der einen wird ein Entwurf gestaltet, in der anderen die Schnitttechnik entwickelt und wiederum in einer anderen Etage die Produktion geplant. Insgesamt arbeiten im Haus rund 1500 Angestellte.
Und Sabrina darf sogar mitentscheiden, was im Trend liegen soll. Wenn sie etwas gemalt hat, wird es der Technikerin gezeigt, die oft noch Verbesserungsvorschläge hat.
Der Beruf Modedesignerin hat Zukunft. Aber es ist schwierig, eine Stelle zu finden. Die meisten, vor allem kleinere Firmen, haben schon Designer und wollen keine weiteren einstellen. Aber große Unternehmen wie C&A suchen immer wieder Modedesigner mit neuen Ideen. Sabrina träumt deshalb von einer Daueranstellung bei C&A.
Natalie Jung, Solingen, Albert-Schweitzer-Schule, Hahnenhausstr.