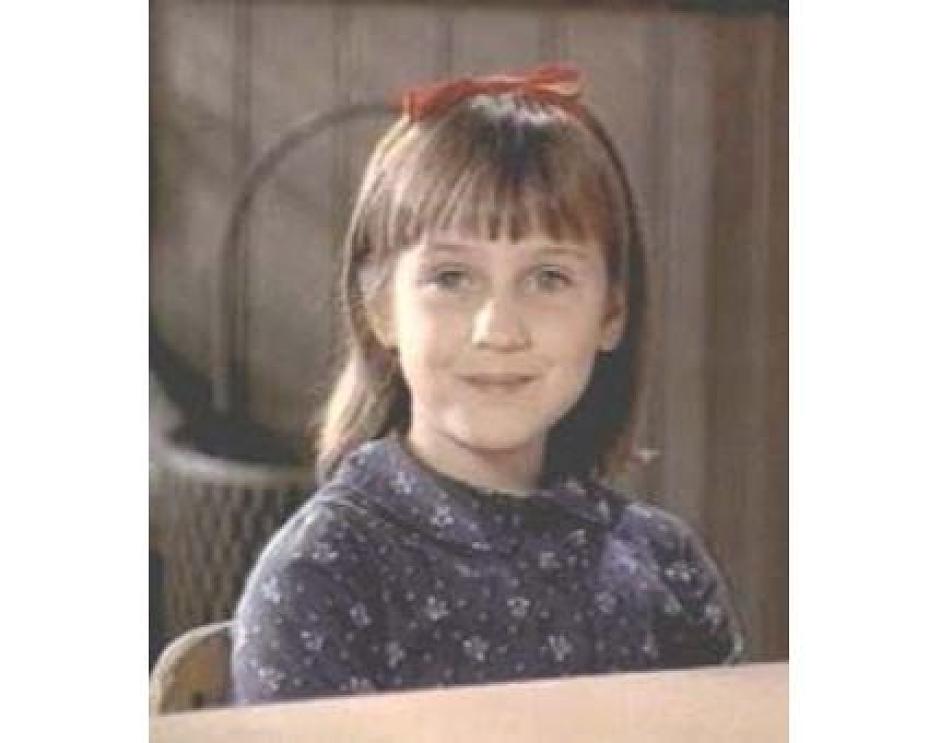Die Schule später beginnen lassen, damit Schüler und Lehrer ausgeschlafener sind. Weniger, aber längere Schulstunden am Tag. Sollte man solche Veränderungen am Andreas-Vesalius-Gymnasium (AVG) Wesel einführen? Dazu wurden vier Lehrer des AVGs befragt – ein Mathe- und ein Erdkundelehrer sowie eine Deutsch- und eine Englischlehrerin.
Wie finden Sie die Schulstunden-Veränderungen?
Mathe-Lehrer: „Ich fände es sinnvoll, dass die Verlängerung eingeführt wird und dass an einem Tag weniger Fächer unterrichtet werden. Jedoch wäre es nicht so gut, dass Nebenfächer dann nur einmal pro Woche sind.“
Erdkunde-Lehrer: „Eigentlich wäre die Stundenverlängerung nicht so gut, aber ein Doppelstundensystem wäre sinnvoll.“
Deutsch-Lehrerin: „Ich fände es einerseits gut, dass die 45 Minuten auf 60 Minuten geändert werden, aber es gäbe auch einen Nachteil für die Nebenfächer, die dann nur einmal pro Woche stattfinden würden.“
Englisch-Lehrerin: „Ich fände die Stundenverlängerung auf 60 Minuten gut, da man dann länger an etwas arbeiten kann. Zum Beispiel bei Gruppenarbeiten.“
Würden Sie empfehlen, die Verlängerung am AVG einzuführen?
Mathe-Lehrer: „Also ich habe es schon empfohlen. Ich fände es gut, die Sache für das nächste Schuljahr mal zu testen.“
Erdkunde-Lehrer: „Ich würde die Verlängerung nicht empfehlen. Ich hätte lieber Doppelstunden!“
Deutsch-Lehrerin: „Ich würde die Verlängerung empfehlen, weil die Schüler dann auch weniger Fächer am Tag hätten und nicht so viele Bücher mitschleppen müssten. Außerdem würde auch mehr Ruhe einkehren.“
Englisch-Lehrerin: „Ich weiß es nicht tun, es kommt darauf an, was möglich gemacht werden kann. Aber ich würde auch Doppelstunden empfehlen, weil dann mehr Ruhe einkehren würde.“
Hätten Sie es lieber, dass die Schule erst um 9 Uhr beginnt?
Mathe-Lehrer: „Ich würde es so lassen, da die Schule jetzt schon recht spät endet.“
Erdkunde-Lehrer: „Ich würde es bei 8 Uhr belassen, weil sonst der Zeit-Rythmus durcheinander käme.“
Deutsch-Lehrerin: „Ich würde die Schule gerne um 9 Uhr beginnen lassen, weil man morgens um 8 Uhr oft noch zu müde ist.“
Englisch-Lehrerin: „Ich persönlich fände den Schulbeginn um 9 Uhr nicht so gut, denn dann käme man später nach Hause und hätte weniger Freizeit. Ich würde die Schule viel lieber um 7.45 Uhr beginnen lassen.“
Welche Änderungen würden Sie noch empfehlen?
Mathe-Lehrer: „Ich finde, es hat keinen Sinn etwas zu ändern, auch weil das AVG mit anderen Schulen zusammenarbeitet und Vereinbarungen mit den Sporthallen hat. Diese müssten dann auch alles ändern, und das wäre zu umständlich.“
Erdkunde-Lehrer: „Außer dem Doppelstundenmodell würde ich nichts anderes einführen.“
Deutsch-Lehrerin: „Das 60-Minuten-Modell wäre besser als die 45-Minuten-Stunden, und ich würde die Schule ab 9 Uhr beginnen lassen.“
Englisch-Lehrerin: „Ich würde die Schule um 7.45 Uhr beginnen lassen, Zehn-Minuten-Pausen einführen, und außerdem fände ich das Doppelstundensystem sinnvoll, weil dann mehr Ruhe einkehrt und man weniger Bücher und Hefte schleppen müsste.
Lena Persing, Wesel, Andreas-Vesalius-Gymnasium