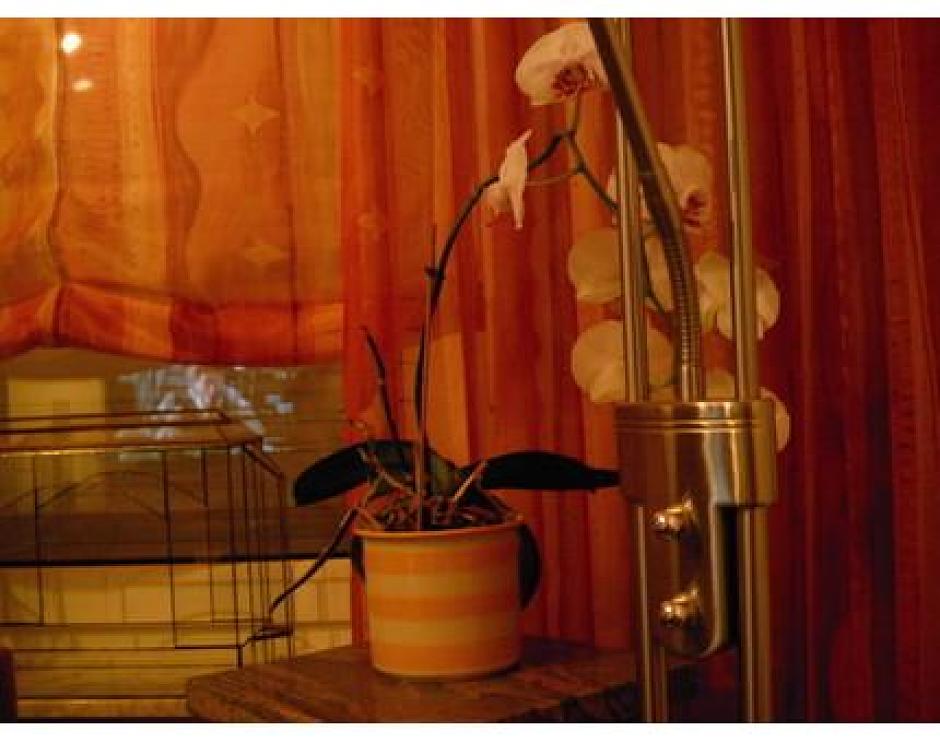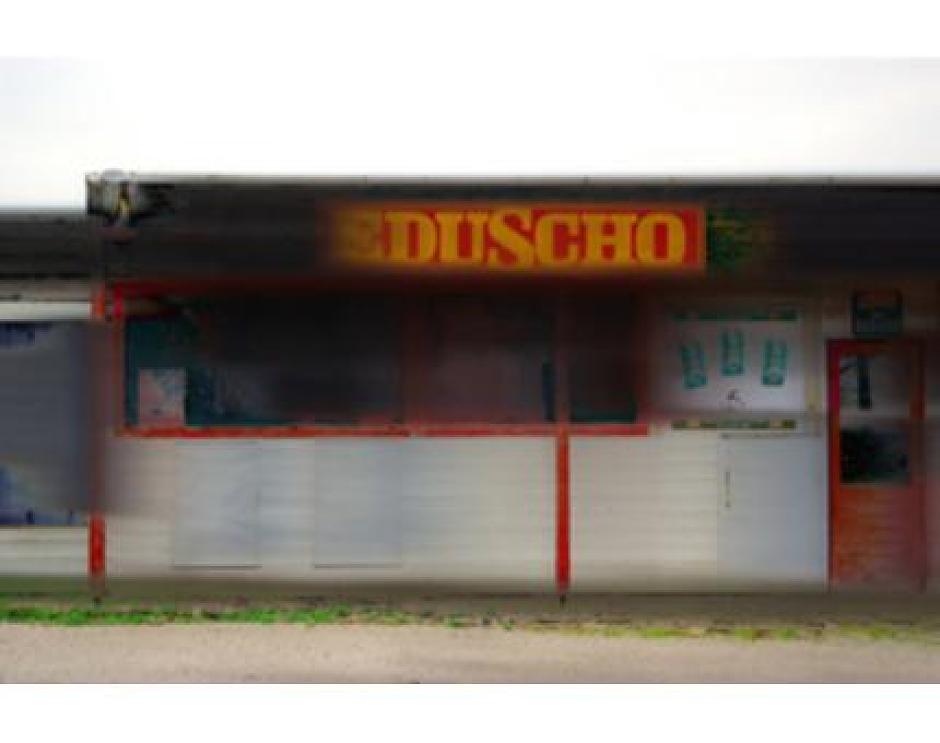„1,40 EUR bitte!“ Er bezahlt, reicht das Geld über den Tresen und kommt mit einer Flasche Bier wieder heraus aus der kleinen Tankstelle. Wir schauen unseren Freund fassungslos an, begleiten ihn zurück und klären die verblüffte Verkäuferin auf, dass dies nur ein Test war. Wir fragen, warum sie nicht nach dem Ausweis des immerhin erst 15-jährigen Klassenkameraden gefragt hat. „Ich dachte, er sei 18. Bei euch hätte ich gefragt!“, ist ihre lahme Ausrede.
Leider kein seltenes Bild, wie sich nach drei Versuchen in einer Tankstelle, einem großen Supermarkt sowie einem Kiosk zeigte. Lediglich in Letzterem gelang es uns nicht, alkoholische Getränke zu kaufen. Nur ein Verkäufer von dreien, der seine Arbeit richtig macht. Der genauer hinsieht.
Wie sich doch die Jugend verändert hat, mag da sicher die eine oder
andere Mutter denken. Wo vor Jahren noch zum Beispiel gemeinsame Ausflüge oder sportliche Aktivitäten an der Tagesordnung waren, sieht es heute anders aus. Zigaretten, Alkoholkonsum oder andere Drogen bestimmen nicht selten das Leben der Teenager.
Doch wieso genau? Die Schuld sei bei mehreren zu suchen, das meinen jedenfalls einige Befragte. Natürlich stehen an erster Stelle wir Jugendlichen selbst. Wir haben es uns scheinbar selbst zuzuschreiben. Aber sollte man doch nicht Verkäufer, Gruppenzwang oder Neugierde außer Acht lassen. Wie leicht man als Minderjähriger innerhalb weniger Minuten an Alkohol kommen kann, davon konnten wir uns heute selber überzeugen.
Hinzu kommt der Gruppenzwang. Wenn jeder Freund mit einer Flasche Bier oder einer Zigarette dasitzt, möchte man mitmachen und dazugehören. Neugierde ist natürlich auch noch da. „Man möchte etwas wagen, Neues ausprobieren“, bestätigt ein Erwachsener, den wir zu diesem Thema befragten.
Daher freuen sich Supermärkte, Kioskbesitzer und Co. weiterhin über ihre großen Einnahmen in Sachen Alkohol. Und unsere Eltern denken sich sicher: „Wieso können wir nichts tun?“ Vielleicht, weil sie sich wohl oder übel manchmal an die eigene Nase fassen sollten. Auch, wenn sie es nicht böse meinen, ist es so: Sie wollen ihren Kindern mehr Freiraum geben, damit es diesen besser geht, als ihnen selbst in ihrer eigenen Jugendzeit. Leider geht das häufig nach hinten los. Oftmals wissen sie nicht, wo ihre Kinder sind und mit wem sie sich gerade treffen.
Nicht selten verabredet man sich nur zum Trinken oder Rauchen. Das so genannte Komasaufen wird man wohl nie verhindern können. Und auch wenn Schlagzeilen wie „Jugendlicher stirbt an gepanschtem Alkohol“ in unseren Köpfen hängen bleiben, sollte man nicht vergessen, dass es auch viele Ausnahmen gibt. Die, die auch ohne Alkohol Spaß haben und sich amüsieren können. Nicht jeder Teenager ab 13 sollte als Säufer verurteilt werden. Sehr viele Kinder unseren Alters kommen auch gut ohne Alkohol und Drogen aus. Und genau diese Kinder sollten zum Thema werden und nicht die, die damit Aufsehen erregen, zu viel Alkohol, Nikotin oder Drogen konsumiert zu haben
Julia Messing, Kalkar, Städt. Gymnasium Kalkar