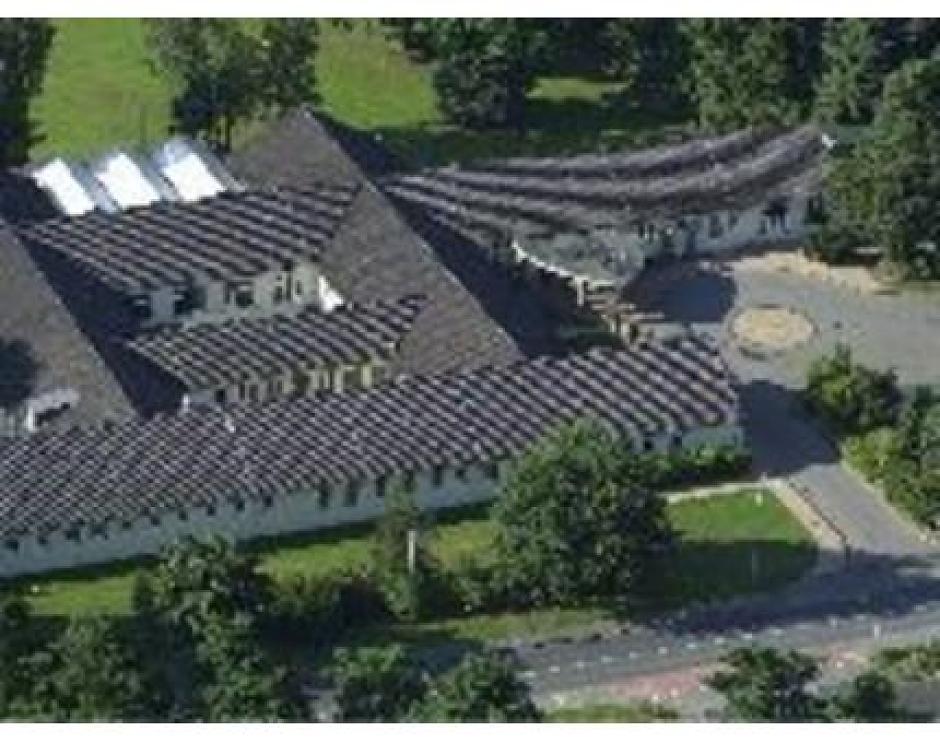An der Internationalen Schule in Düsseldorf (ISD) gibt es ein Sportturnier gegen andere internationale Schulen in ganz Europa. Basketball, Fußball, Volleyball und Leichtathletik gehören zu den beliebtesten Sportarten. Die Schüler, die die so genannten Try-Outs bestehen, repräsentieren die ISD. Das Turnier nennt sich NECIS.
Die Basketballsaison fängt im November an und endet Mitte März. Um die zwölf Athleten kann jeder Trainer mitnehmen. Das spezielle an NECIS ist, dass es Vor-Turniere gibt, für die die verschiedenen Mannschaften zu verschiedenen Schulen reisen, wo sie dann gegen andere NECIS Mannschaften spielen.
„Es macht am meisten Spaß, bei den verschiedenen Spielern zu übernachten, auch wenn man Konkurrent ist. Man lernt neue Kulturen kennen, und man entkommt die Schule auch noch dazu“, sagt Mona Gerken aus Deutschland, ein Mädchen aus der 9. Klasse, die schon seit fünf Jahren bei NECIS teilnimmt.
Die Spieler haben um die vier Vor-Turniere und ein letztes Turnier, bei dem alle Schulen zusammenkommen und um die großen Pokale kämpfen. „Wenn wir das letzte große NECIS Turnier haben, macht es am meisten Spaß! Ich liebe es, wenn wir im Hotel schlafen können, nur mit besten Freunden! Obwohl ich schon traurig bin, dass es so schnell zu Ende ist, und dass ich bis nächstes Jahr warten muss, bis der Spaß wieder anfängt“, sagt Risa Hotta, ein japanisches Mädchen, das für die U-16-Basketball-Mannschaft spielt.
„Auch wenn man vielleicht nicht im Finale steht, jubelt man trotzdem für die andere Mannschaften! Ein echter Teamgeist“, sagt Emily Young aus Australien, die das dritte Jahr von NECIS jetzt beginnt.
Die Internationale Schule Düsseldorf hat eine gute Reputation, nicht nur im Basketball sondern auch in den anderen NECIS Sportarten. Deshalb ist etwas für jeden dabei. Ein toller Grund, an der Internationalen Schule Schüler zu werden!
Victoria Scherpel, Düsseldorf, International School Of Düsseldorf