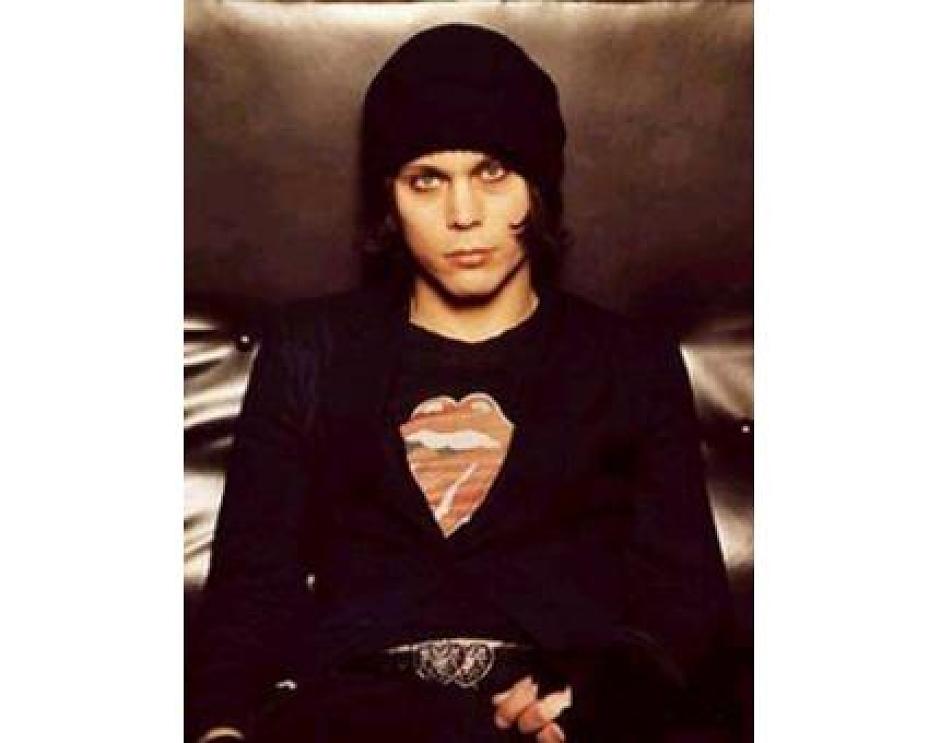Trotz großer Proteste wurde es in allen Bundesländern eingeführt: Das Abitur in 12 Jahren (G8).
Politiker waren der Meinung, dass Schüler früher studieren oder einen Beruf erlernen sollten, da die Deutschen im Vergleich zu anderen Ländern (Großbritannien und Frankreich) eine sehr lange Schulzeit haben. Im Schnitt sind wir mit 28 Jahren mit dem Studium fertig – in Frankreich starten die Studenten zwei bis drei Jahre früher in den Beruf.
Doch G8 hat auch viele Nachteile: Die Belastung für Schüler und Lehrer ist extrem hoch, da auch nachmittags Unterricht stattfinden muss, um den komprimierten Lehrplan zu schaffen. Diese Überlastung kann bei Mädchen zu psychosomatische Störungen und bei Jungen zu verstärkt aggressivem Verhalten führen. Außerdem hat die Flucht in Medikamente, aber auch in legale und illegale Drogen und Aufpuschmittel zugenommen.
Eine Mutter beklagt sich darüber, dass ihre 13-jährige Tochter keine Zeit mehr für Hobbys, Sport und Freunde habe und über Stresssymptome wie Erschöpfung, Bauchweh, Kopfschmerzen, Einschlafprobleme und Depressionen klage. Kinder aus ihrer Klasse schliefen im Unterricht ein oder hielten nur mit Cola und Kaffee durch.
Auch Lehrer sind teilweise überfordert oder zumindest stark gestresst, da auch Nachmittagsunterricht eingeführt wurde und sie den selben Stoff in weniger Zeit übermitteln müssen. Außerdem haben sie dadurch weniger Zeit zur Vorbereitung des Unterrichts und zur Korrektur von Klausuren. Ein weiterer Nachteil ist, dass viele Schulen keine Mensa haben und somit viel Geld für die Einrichtung ausgeben müssen.
Es gibt jedoch nicht nur Nachteile: Es wird bald mehr Arbeitskräfte geben. Viele Schüler fühlen sich nicht überlastet. Außerdem sind zwölf Jahre Schule in manchen Bundesländern schon länger Alltag, es änderte sich also für sie nichts. Bei Nachforschungen wurde deutlich, dass viele G8 für überflüssig halten, allerdings nicht glauben, dass es wieder abgeschafft wird, weil es eine langjährige Entscheidung war und weil die Regierung keinen weiteren Fehler in der Schulpolitik eingestehen will.
Die Befragten halten es für eine Schnellschussentscheidung, und zwei Drittel der Befragten würden es gerne wieder abschaffen bzw. neu überdenken. Im Moment wird über Samstagsunterricht nachgedacht, weil die Schüler zwischen einem und vier Nachmittagen pro Woche Unterricht haben. So könnte man in einigen Bundesländern einen weiteren Tag anhängen und den Unterricht entzerren.
Wahrscheinlich wird G8 in vielen Jahren immer noch ein aktuelles Diskussionsthema sein. Es gibt noch viele Probleme zu lösen.
Janina Pohl, Annika Kantert & Sofie Ehrhardt, Mänchengladbach, Gymnasium Odenkirchen