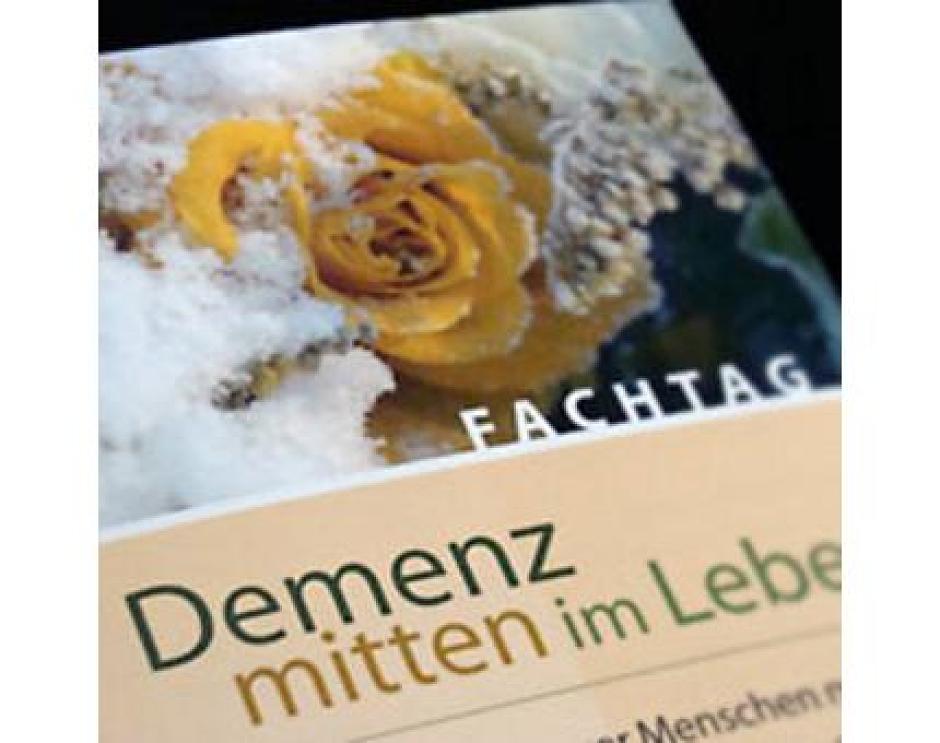„Hoffentlich sehe ich Euch nie wieder!“ – bei einem solchen Abschiedsgruß wäre man ja normalerweise sauer, aber wir hatten einen ähnlichen Wunsch. Wie kann das sein? Das Rätsel lässt sich schnell lösen: Gemeinsam mit unserer Klasse besuchte ich Ende November die Vollzugsanstalt an der Heyestraße, Abeilung Jugendarrest.
Nachdem wir kontrolliert worden waren, erzählte uns der Leiter der Jugendarrestanstalt ausführlich etwas über das Haus und die Regeln, die hier einzuhalten sind.
Die Vollzugsanstalt ist vor drei Jahren gegründet worden. In der Anstalt können bis zu 60 Plätze belegt werden. Meist gibt es Einzelzellen. Sollte ein Insasse krank sein (z.B. bei Allgergien), dann werden auch schon einmal zwei Personenin einer Zelle untergebracht. Die Zellen sind sieben bis acht Quadratmeter groß – mit Lokus. Die Zellen müssen von den Gefangenen in Ordnung gehalten werden. Die Duschen sind auf dem Flur; geduscht werden kann zwei Mal in der Woche und jeweils nach dem Sport.
Der Leiter der Anstalt ist von Beruf Jugendrichter. Er arbeitet zwei bis drei Tage in der Woche im Gericht und die anderen Tage in der Anstalt. Außer ihm sind 20 weitere Mitabeiter dort beschäftigt, die im Schichtwechsel arbeiten.
In dem Jugendarrest Heyestraße sind nur Jungen, die Mädchen werden in anderen Städten untergebracht. Die Jugendlichen sind mindestens 14 Jahre alt, weil man mit 14 strafmündig wird. Im Jahr durchlaufen etwa 2200 Jugendliche den Arrest, sie kommen nicht nur aus Düsseldorf, sondern auch aus der weiteren Umgebung.
In der Anstalt sind natürlich Regeln einzuhalten. Es gibt drei Mahlzeiten am Tag. Der Leiter bezeichnet das Essen als „nahrhaft“. Döner, Pizzen und Pommes sind nicht drin, denn für die Verpflegung kriegt die Anstalt 2,50 Euro pro Insasse für den ganzen Tag. Das Essen wird nicht von den Jugendlichen zubereitet, sondern von der JVA Ulmenstraße geliefert.
Die Vollzugsbeamten verteilen Punkte für gutes Benehmen und Verhalten. Mit diesen Punkten darf man dann Kickern, Billard spielen, Fernsehen und einiges mehr. Beim Fernsehen braucht man sich nicht um die Programme zu zanken, denn es wird nur ein Programm für alle angeboten. Es können maximal 28 Punkte erreicht werden, für schlechtes Verhalten, wie zum Beispiel aus dem Fenster rufen, gibt es Minuspunkte.
Besuche sind nicht erlaubt, Handys sind ebenfalls verboten. In Notfällen kann man anrufen, wenn man die Erlaubnis bekommt. Alkohol, Rauchen, Drogen sind selbstverständlich auch strikt verboten. Verstöße führen zum sofortigen Verlust aller erworbenen Punkte, bei einem Drogenfund erfolgt Strafanzeige.
Der Leiter erklärte uns, dass fast alle jugendlichen Straftäter Kiffer sind, und dass ihr Drogenkonsum zu kriminellem Verhalten geführt habe. Er hatte auch schon Fälle, bei denen Jugendliche einsitzen mussten, weil sie geschwänzt hatten oder durch mehrfaches Schwarzfahren aufgefallen sind. Übrigens: Schüler müssen am Wochenende oder in den Ferien ihre Zeit absitzen.
Am Ende unseres Besuches war klar: Hoffentlich sehen wir diese Anstalt nie wieder von innen!
Ersan Zekir, Düsseldorf, Adolf-Reichwein-Schule