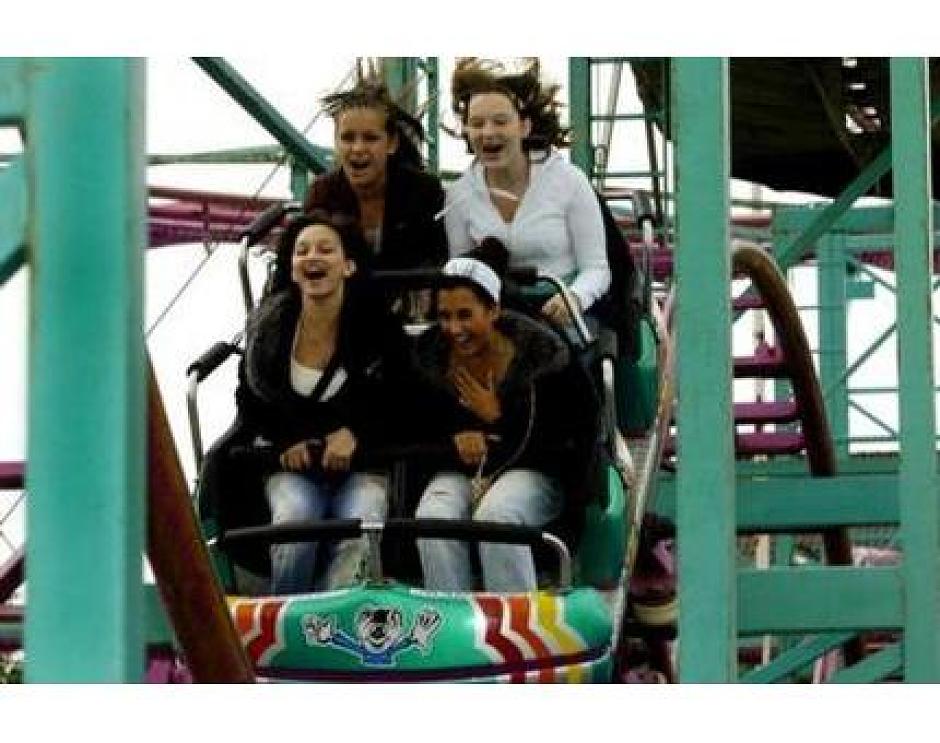Die Krankenbruderschaft Rhein-Maas organisiert jedes Jahr eine Behindertenwallfahrt nach Südfrankreich. Die Mitreisenden werden betreut, gepflegt und unterhalten.
Alles schwankt und wackelt. Julia läuft mit einem Tablett, auf dem sechs Teller mit Suppe stehen, zum Abteil sieben. Beim öffnen der Türe passiert es: Julia verschüttet die Suppe auf dem Gang. Sie rennt in den Küchenwagen, um etwas zum Wegwischen zu holen. Auch wenn man als Teammitglied in dem Küchenwagen essen will, ist dies nicht so einfach, denn man muss stehen und alles wackelt, da kann es schon mal passieren, dass etwas daneben geht.
Menschen aus der ganzen Welt fahren nach Lourdes, um die heilige Mutter Gottes zu verehren und das berühmte Lourdeswasser zu trinken.
Besonders für kranke Menschen stellt dies einen besonderen Reiz dar, da einzelne Fälle bekannt sind, bei denen eine Heilung durch das Lourdeswasser erfolgte.
So konnten einzelne Menschen, die im Rollstuhl saßen, nach einer Lourdeswallfahrt wieder gehen, oder unheilbar Kranke wurden gesund. Die Rhein-Maas Bruderschaft hat es sich zur Aufgabe gemacht, Menschen mit und ohne Behinderung nach Lourdes zu bringen.
Da die Teilnehmer nicht per Flugzeug fliegen können und auf der Fahrt medizinische Versorgung benötigen, fährt das Team der Rhein-Maas Bruderschaft mit ihnen im Zug. In Lourdes angekommen, erhalten die Pilger die Betten im Hospital, das extra zu diesem Zweck errichtet wurde. Jeden Tag geht es zu einer Messe, zu der die Kranken von den Helfern der Bruderschaft gebracht werden.
„Wir sind den Leuten hier alle sehr dankbar, das ist die schönste Woche im Jahr“, sagt einer der behinderten Pilger. Pilger, die mitgefahren sind, können ihren Aufenthalt in Lourdes selbst gestalten. Die Kranken werden die ganze Woche über Tag und Nacht betreut, gepflegt und unterhalten.
Wenn der Zug den Bahnhof von Lourdes verlässt, schauen alle noch ein letztes Mal wehmütig auf den heiligen Bezirk mit den vielen Menschen zurück.
Jeder freut sich auf ein nächstes Mal, obwohl die Woche für alle sehr anstrengend war und alle nun sehr müde sind. Lourdes liegt im Südwesten Frankreichs. 1858 soll dort der heiligen Bernadette die Mutter Gottes erschienen sein. Die weiß gekleidete Frau sagte zu ihr, sie solle sich mit der Erde vor ihr das Gesicht waschen. Bernadette tat dies, und kurz danach war an dieser Stelle eine Quelle, der heilende Kräfte nachgesagt werden.
Julia Becker, Marina Lamers, Lena Liffers, Mänchengladbach, Bisch. Marienschule