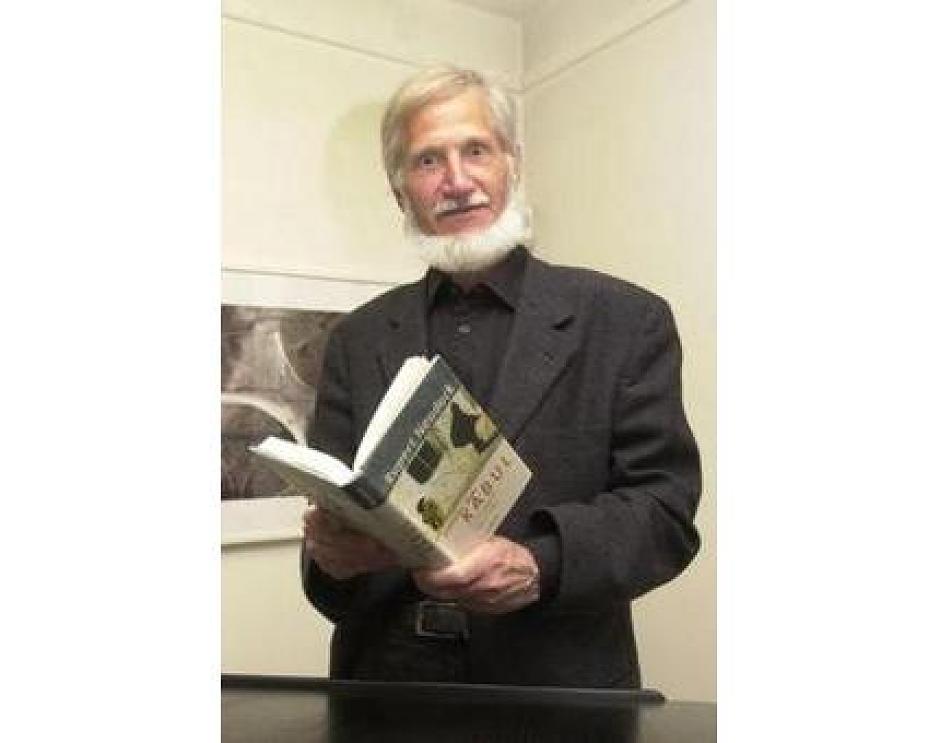Die Jugend musiziert, und das gar nicht mal schlecht. Immer mehr Jugendliche finden Gefallen an der Musik. Und dabei geht es nicht nur ums Musikhören. Nein, die meisten jungen Leute stellen sich selbst hinters Mikro. Egal ob Gitarre, Schlagzeug oder Bass: Die Hauptsache ist der Spaß. Beliebte Musikrichtungen sind Punkrock, Grunge, Ska, Reggae oder Spaßpunk.
In Mönchengladbach bekanntere Schülerbands wie zum Beispiel „Inge’s Hosenträger“, „One Short Poetry“, „Lili Punkstrumpf“, „No Brain No Pain“ und „Night Creatures“ kann man auf öffentlichen Veranstaltungen wie dem Crossover in der Bischöflichen Marienschule Mönchengladbach oder dem Citymovement der Stadt Mönchengladbach antreffen. Die meisten Schülerbands covern einige bekannte Stücke, schreiben ihre Songs aber zum Großteil selbst. Diese Songs können politische Meinungen vertreten oder einfach nur zur Unterhaltung dienen.
Vorbilder der jungen Musiker sind oft Berühmtheiten wie „Die Ärzte“, „Sondaschule“, „Terrorgruppe“, „Die Toten Hosen“, „Nirvana“ oder die „Beatsteaks“. Die Musik ist für Jugendliche ein wunderbares Mittel, um sich auszudrücken und ihrer Kreativität freien Lauf zu lassen.
Ein anregendes Beispiel für eine Spaßpunk-Band ist „ThebLa“. Sie besteht aus einer Sängerin (Cira Las Vegas), einem Schlagzeuger (Frank Röthgens), zwei Gitarristen (Ricco Löschner und Stian Koßmann) und einem Bassisten (Michael Flintz). Bis jetzt wurden alle Lieder von der Sängerin Cira Las Vegas geschrieben. Als Frontfrau werde sie jedoch nicht angesehen, so Gitarrist Stian Koßmann.
„Bei uns in der Band haben alle etwas zu sagen. Es gibt keine feste Rangordnung.“ Gegründet wurde die Band im Sommer 2006 und existiert bis heute. Dazu tragen bestimmt auch die Crew und die Fans, zu denen unter anderem wir, Leya Jerzy und Nadine Ponto, gehören, bei. Mehr über „ThebLa“ gibt es auf der Homepage der Band: www.the-bla.de.
Leya Jerzy, Nadine Ponto, Mänchengladbach, Bisch. Marienschule