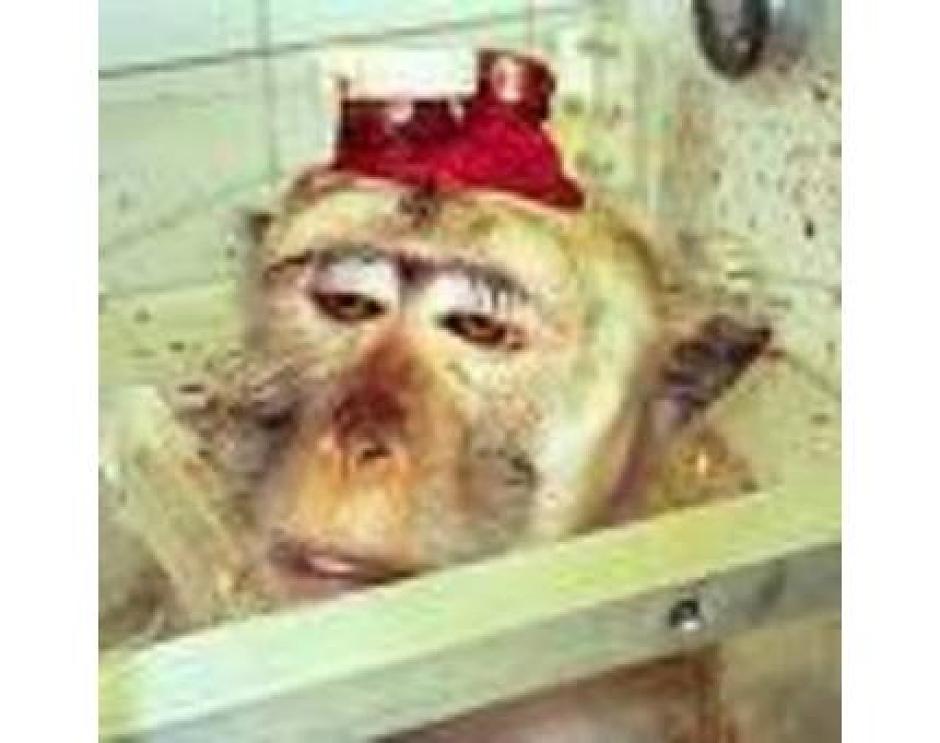Eine lächelnde Frau tritt herein. Sie gehört zum Verein Hippo-Canis-Shelter. Dieser Verein bringt Hunde aus Tötungsstationen in Ungarn und Spanien nach Deutschland, die nach ein bis vier Wochen in ihren Herkunftsländern umgebracht werden würden.
In den ersten zwei Wochen können sie von ihren Herrchen abgeholt werden, falls sie nur weggelaufen sind. In den weiteren zwei Wochen können sie von Tierschutzvereinen, wie zum Beispiel Hippo-Canis-Shelter, gerettet werden und ihrem sicheren Tod entkommen.
Diese Hunde werden erstmal in einem Tierheim, das mit dem Verein zusammenarbeitet, aufgepäppelt, gechipt und mit genügend Futter versorgt. Wenn sie gut auf die Reise vorbereitet sind, können sie sich auf ein viel besseres Leben in Deutschland freuen. Doch es dürfen noch längst nicht alle Hunde nach Deutschland. Erst wenn der Amtsveterinär bestätigt hat, dass sie keine gefährlichen Krankheiten haben, können sie die lange Reise nach Deutschland antreten.
Hunde aus südlicheren Ländern werden von Flugpaten per Flugzeug nach Deutschland eingeflogen. Die Hunde aus Ungarn wurden früher mit einem relativ günstigen Transportunternehmen nach Deutschland gebracht, doch aufgrund einer Preiserhöhung kann sich der Verein dies nicht mehr leisten und muss sich nach einer langfristigen Lösung umsehen. Deshalb sammelt der Verein zurzeit Spenden für einen eigenen Transporter.
Wenn die Hunde in Deutschland angekommen sind, werden sie nicht nach ihrer schweren Zeit in Ungarn auch noch, wie üblich, in Zwingern gehalten, sondern kommen in Pflegefamilien.
Um 6 Uhr müssen die ersten Hunde Gassi gehen. Doch dann fängt erst der richtige Arbeitstag an. “ Manchmal reichen selbst 24 Stunden nicht aus“, sagt Elke Weichold, Mitgründerin des Vereins. Um 7 Uhr werden die Hunde gefüttert. Damit keine Langeweile aufkommt, brauchen sie viel Aufmerksamkeit. Einige sind nicht stubenrein, deswegen ist das Chaos schon vorprogrammiert: „Waschen, putzen, waschen, putzen, so geht das eigentlich den ganzen Tag“, erzählt Elke Weichold.
Um zu sehen, ob die Tiere sich wohlfühlen und artgerecht gehalten werden, besuchen Mitglieder des Vereins die Familien nach der Vermittlung.
Der Verein wurde aus einer Notsituation von Rainer Richter (1. Vorsitzender) , Bettina Scharting (2. Vorsitzende ) und Elke Weichold (Kassenwärtin) gegründet. Sie wollten die Tiere retten, weil sie sonst erfroren wären. Da sie keinen Hundehandel betreiben wollten, entschlossen sie sich, einen Verein zu gründen.
Caroline Makuyana, Joana Mai und Tatjana Bernhardt, Düsseldorf, Städt.gymnasium Koblenzer Straße