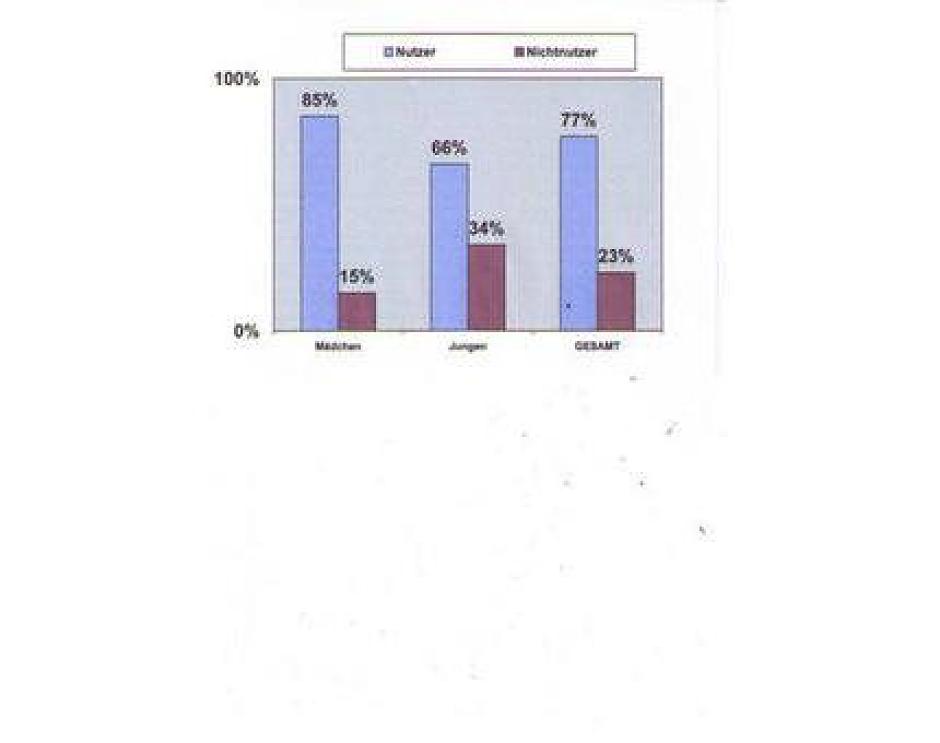Gegen Sommerende oder im Herbst verlassen 45 Prozent unserer einheimischen Vögel das Land und somit auch ihr Brutgebiet. Bei einigen Vogelarten fliegen nur die Weibchen in den Süden. Man nennt sie Teilzieher. Die Männchen bleiben den Winter über hier und besetzen frühzeitig einen Brutplatz.
Der Vogelzug ist eine auffällige,aber immer noch geheimnisvolle Tierwanderung. Unsere Zugvögel(z.B. Kuckuck, Haubentaucher, Kraniche, Gänse, Enten) ziehen von der im Winter herrschenden Kälte fort. Doch ein ein weiterer Grund für den Vogelzug ist die Suche nach Nahrung. Da viele Vögel Insektenfresser sind, finden sie nur im Frühjahr und im Sommer reichlich Nahrung.
Die Zugvögel fliegen mehrere Wochen über 10000 km weit in ein wärmeres Land.Das Hauptziel ihrer Reise sind oft Länder in Afrika und Südeuropa. Bachstelzen überwintern beispielsweise in Nordafrika und der Kuckuck in Mittelafrika.
Durch ihre großartigen Fähigkeiten, z.B.der Kompassorientierung und der Navigation, können sie problemlos ihr Reiseziel finden. Auch orientieren sich die Zugvögel am Sternenhimmel und am Stand der Sonne sowie an Landmarken und am Erdmagnetfeld.
Um ihre Reise zu überstehen leben sie von ihrem Körperfett um Energie zu gewinnen.
Doch es lauern auch einige Gefahren auf die Zugvögel,da sie über Länder hinweg fliegen in denen Jagd auf Vögel gemacht werden. Auch ist es für die Vögel sehr riskant bei Unwetter zu fliegen.
Jeder Vogel fliegt unterschiedlich in ein wärmeres Land. Einige fliegen alleine, andere wiederum fliegen in Scharen. Manche benötigen mehr, andere brauchen weniger Pausen zwischen ihrer langen Reise.
Kraniche und Gänse fliegen in dem sogenannten Keilflug. Enten bewegen sich in geraden Linien fort und Haubentauer wiederum fliegen in einer Kette nebeneinander. Im Frühjahr ist es dann endlich wieder soweit, die Zugvögel kehren zurück in ihre Heimat um zu brüten. Unwetter, Kälteeinflüsse und überdurchschnittlich warme Temperaturen können die Rückkehr der Vögel beeinflussen. Doch normalerweise finden die meisten Zugvögel von Ende März bis Mitte Mai in ihr Land zurück.
Mira Nies, Hilden, Erzbischäfliche Thersienschule