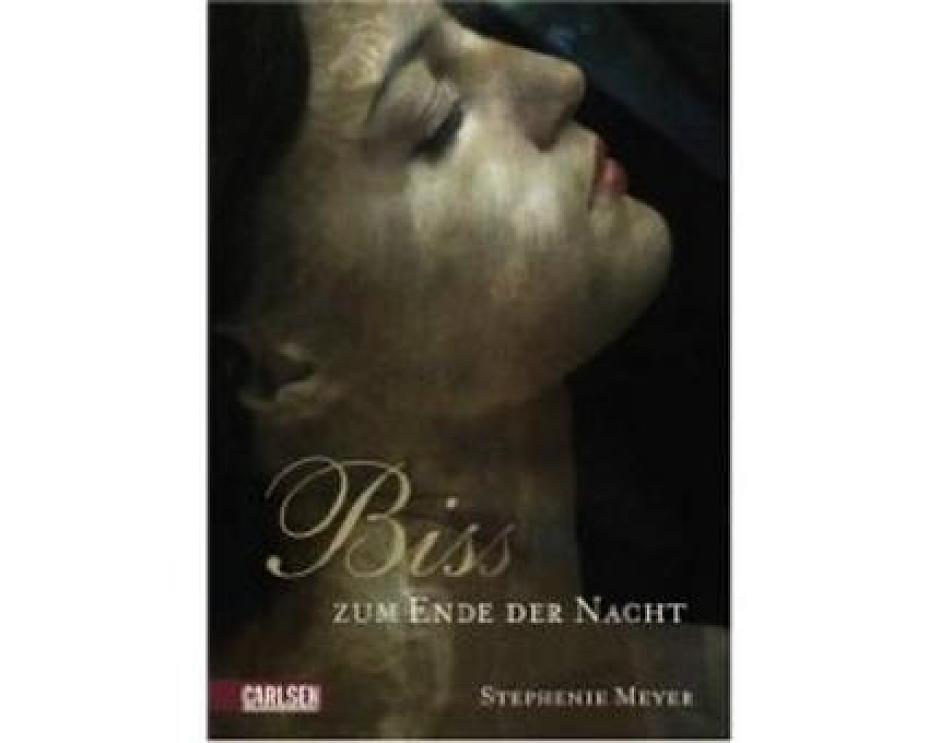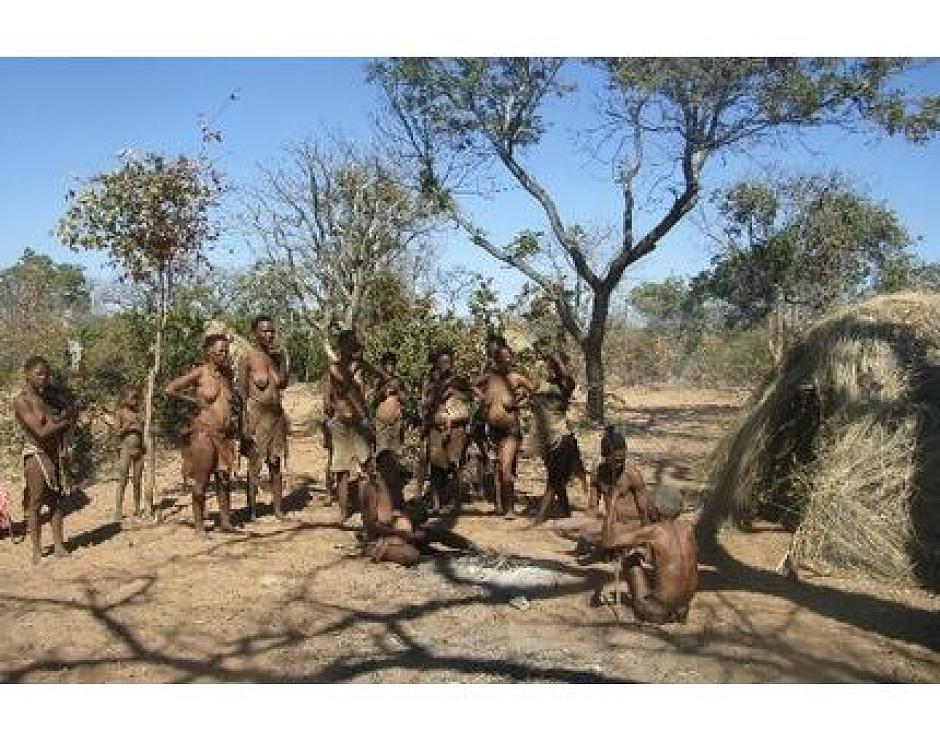Florian Rothenberg hat Profi-Basketballer Dieter Kuprella einige Fragen gestellt:
Wie bist Du eigentlich zum Basketball gekommen, und wer waren Deine sportlichen Vorbilder?
Das ist eine lustige Geschichte: Ich war Leichtathlet in Gelsenkirchen, und wir haben Wintertraining in der Halle gehabt. Nach dem Training haben wir dann kein Basketball, aber mit einem Basketball gespielt, und das hat uns mehr Spaß gemacht. So hat sich die ganze alte Leichtathletikmannschaft Schritt für Schritt für den Basketball entschieden. Ich habe damals mit 14 Jahren angefangen und habe dann sehr schnell große Fortschritte gemacht. Ich hatte keine großen sportlichen Vorbilder. Ich komme ja mitten aus dem Ruhrgebiet, und da ist und war ja der Fußball Trumpf. Es gab zwar immer wieder Personen, an denen ich mich orientiert habe, weil ich sie gut fand, aber Vorbilder gab es damals für Basketball in Deutschland sowieso nicht.
War es lukrativ, als Profi in den 1960er und -70er Jahren in Deutschland zu spielen?
Nein, überhaupt nicht. Ich habe zwar als Profi gespielt, aber kein Geld bekommen. Ich bin Diplom-Betriebswirt und habe hauptberuflich bei Bayer in Leverkusen gearbeitet.
Wie war die Stimmung bei den Meisterschaftsspielen in der damals neuen Wilhelm-Dopatka-Halle?
Wir haben erst in der Kurt-Ries-Halle gespielt. Bei einem Finale waren 1600 Leute in der Halle, da wurden extra Stahlgerüste aufgebaut. Die Stimmung war bombig. Basketball war „die Sportart“ in Leverkusen In der Dopatka-Halle hatten wir dann schon einen Schnitt von über 2000 Leuten. Wir hatten also damals schon einen sehr guten Background.
Du warst 1972 Teilnehmer bei den Olympischen Spielen in München. Für Megastar Dirk Nowitzki war Olympia „ein riesiger Traum“. War es für Dich auch der größte Erfolg Deiner Kariere?
Es war ein unglaublich wichtiger Faktor in meiner Kariere. Ich muss dazu sagen, im Oktober 1971 hatte ich mir einen Archillessehnenabriss zugezogen und bis Olympia 1972 war es für mich eine schwere Zeit. Damals ging es mit dem Auskurieren von Verletzungen nicht so schnell. Olympia war für mich dann ein bisschen ernüchternd. Ich habe nicht diese Leichtigkeit gespürt, von der Nowitzki geschwärmt hat. Da gab es eine Reihe Stars, aber der normale Olympiateilnehmer war damals nicht unbedingt der, der von den Medien gesehen wurde. Es war natürlich ein tolles Erlebnis vor über 80000 Zuschauern ins Olympiastadion einzumarschieren. Das war ein Gefühl -ungeheuerlich!
Dann gab es ja das Attentat auf die israelische Nationalmannschaft. Habt Ihr viel davon mitbekommen und hattest Du Angst?
Als das schreckliche Attentat geschah haben wir noch gespielt. Das war zwar nicht weit von unserem Spielort, aber Angst hatte ich nicht. Dann sind erst einmal alle sportlichen Veranstaltungen bis zur Trauerfeier gestoppt worden.
Hattest Du Kontakt zu den Olympia-Stars wie Marc Spitz oder Heide Rosendahl?
Ich bin der Trauzeuge von Heide Rosendahl und John (Ecker). Wir sind befreundet, und John Ecker war ein fantastischer Basketballer. Wir hatten im damaligen Verein TuS 04 Bayer Leverkusen sehr enge Kontakte untereinander. Wir waren damals wie eine große Familie.
Du hast dann 1977 Deine aktive Kariere beendet. Nach vielen verschiedenen Trainerstationen und großen Erfolgen bist du 2008 dann zum TuS 82 Opladen gewechselt, um das Amt als CO-Trainer anzunehmen. Was für Chancen siehst Du hier?
Ich sehe hier mehr Probleme, als ich erwartet habe. Ich hatte vor Saisonbeginn gehofft, das Moritz Thimm und Martin Schlensker beim TuS 82 Opladen bleiben. Wir hatten auch ausgemacht, dreimal die Woche zu trainieren. Von daher bin ich schon ein bisschen enttäuscht, und die Frage ist einfach, was hier noch machbar ist? Ich arbeite jedenfalls gerne mit jüngeren Spielern. Da sehe ich Fortschritte, da sehe ich Entwicklung, die ich selbst beeinflussen kann!
„Superstar“ Dirk Nowitzki kommt langsam in die Jahre. Wie siehst Du denn die Chancen des deutschen Basketballs in den nächsten fünf bis zehn Jahren?
Ganz einfach: schlecht. Mit viertklassigen Amerikanern in der ersten Liga, die in Amerika nicht spielen dürfen. Diese Spieler scheinen alle viel wichtiger zu sein, als die jungen deutschen Basketballer. Bundestrainer Dieter Bauermann hat ja selbst als langjähriger Vereinstrainer (Leverkusen, Bamberg) keine Entwicklungsarbeit für junge deutsche Spieler geleistet. Jetzt predigt er dies natürlich, weil er gerne gute Nationalspieler hätte. Aber er war ja auch einer derjenigen, der junge Talente – die es auch in Leverkusen gegeben hat – auf der Bank hat „verhungern“ lassen.
In Leverkusen gibt es seit dem vergangenen Jahr keine Profimannschaft mehr. Das Regionalliga-Team des TSV hat junge, hoffnungsvolle, deutsche Spieler. Denkst Du, dass es in den nächsten Jahren noch mal ein Profiteam in Leverkusen geben wird?
Ein Profiteam bedeutet Geld. Dieses Geld wird es im ausreichenden Maße nicht mehr in Leverkusen geben. Meiner Meinung nach sehe ich hier zurzeit kein tolles Team. Das Regionalliga-Team wird von zwei amerikanischen Profis „beherrscht“. Hier muss ich mich doch fragen: „Wer hat hier die Verantwortung?“. Man muss jungen Spielern mehr Verantwortung geben, denn mit Verantwortung wachsen sie!
Und was ist mit der neuen Nachwuchs-Basketball-Bundesliga (NBBL)? Siehst du hier Chancen?
Ich sehe da noch keine vernünftigen Strukturen. Das ist nur ein anderes Wort für das, was bisher war. Die Mannschaft fährt jetzt halt bis nach Oldenburg und spielt da. Früher sind wir nur bis nach Münster oder Hagen gefahren.
Letzte Frage zum TuS 82 Opladen: Abstieg aus der Regionalliga 2?
Nicht-Absteiger! Das wäre das erste Mal, dass ich mit einer Mannschaft, die ich betreue, absteigen würde.
Zur Person:
Dieter Kuprella wurde am 5. Februar 1946 in Gelsenkirchen geboren. Von 1968-1977 spielte er beim damaligen TuS 04 Bayer Leverkusen in der Basketball-Bundesliga. Er ist 108-facher Nationalspieler und Olympiateilnehmer 1972 in München. Seit über 40 Jahren ist er glücklich verheiratet und hat drei Kinder. Sohn Helge war ebenfalls Basketballprofi. Aktuell ist er Co-Trainer der 1. Herren des TuS 82 Opladen.
Stationen:
1968-1977: Profi beim TuS 04 Bayer Leverkusen
1977: Trainer der 2.Mannschaft
1977-1982: Trainer der männlichen A-Jugend
1982-1984: Co-Trainer der Frauennationalmannschaft (unter dem jetzigen NBA-Coach Tony DiLeo)
1986-1991: Jugendtrainer beim TSV Bayer 04 Leverkusen
1992-1996: Jugendtrainer beim ETB Essen
2004-2008: Jugendtrainer beim BBZ Leverkusen
seit 2008: Co-Trainer der 1. Herren des TuS 82Opladen (2.Regionalliga).
Erfolge:
• Deutscher Meister: 1970, 71, 72, 76
• Deutscher Pokalsieger: 1970, 71, 74, 76
• Deutscher Meister als Jugendtrainer (A-Junioren) 1980, 81, 82, 90
Florian Rothenberg, Leverkusen, Werner-Heisenberg-Schule