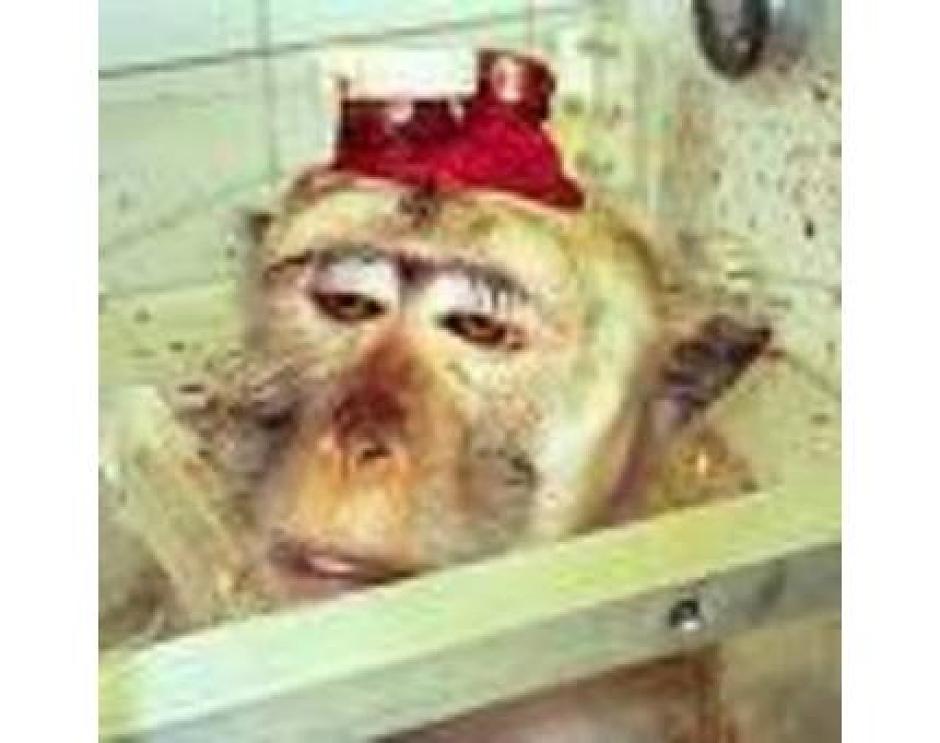Nicolas Schindler hat sich mit der Besitzerin der Düsseldorfer Hundekuchenbäckerei Dog’s Deli, Frederike Friedel, unterhalten.
Wie sind sie auf die Idee gekommen eine Hundekuchenbäckerei aufzumachen? War das Ihr Traumjob?
Es fing an mit meinem Hund Bill, dessen gutes Benehmen mit einem Leckerli belohnt werden sollte. Als ich Bill die üblichen Leckerlis geben wollte, rochen diese nicht gut, denn die meisten werden aus Abfällen hergestellt. Ende November 2004 bekamen wir Bill, und die Idee für Dog’s Deli entstand im Januar 2005. IM November 2006 haben wir Dog’s Deli dann eröffnet. Momentan ist es auch mein Traumjob.
Wer testet Ihre Leckerlis?
Mein Hund Bill testet alle neuen Rezepte.
Was für Delikatessen verkaufen Sie denn?
Kekse für Hunde als Ergänzungsnahrung.
Wer kauft bei Ihnen ein? Was sind das für Menschen?
Es fängt an beim Schüler und hört beim Rentner auf. Wir backen aber auch zum Beispiel für die Gäste des Interconti-Hotels.
Welche Kekse sind am beliebtesten? Was für Kekse gibt es jetzt in der Vorweihnachtszeit?
Also, es hängt immer vom Hund ab, was er halt gewöhnt ist, aber `Bananas` sind sehr beliebt. In der Vorweihnachtszeit, gibt es `Elch-Kekse`. Sie werden in Elch-Form und mit Zimt gebacken.
Wofür werden die Kekse meistens benutzt?
Für Belohnungen, Trainings, Beschäftigen und Verwöhnung.
Wie und wo werden die Kekse gebacken?
Alle Kekse werde im Geschäft gebacken, haben keine Konservierungsmittel, sind ohne Zucker und ohne künstliche Aromen.
Wie viele Kilo Kekse werden pro Tag verkauft? Und wie teuer sind 100 Gramm?
In der Vorweihnachtszeit werden bis zu 30 bis 40 Kilo am Tag verkauft. Es ist unterschiedlich, aber 100 Gramm kosten zwischen 1,95 und vier Euro.
Würden Sie Ihre Hundekuchenbäckerei als Marktlücke bezeichnen?
Ja, das ist definitiv eine Marktlücke, ich habe auch schon viele Anfragen bekommen für Laden-Eröffnungen in ganz Deutschland. Viele Kekse kann man auch selbst essen.
Nicolas Schindler, Düsseldorf, International School Of Düsseldorf