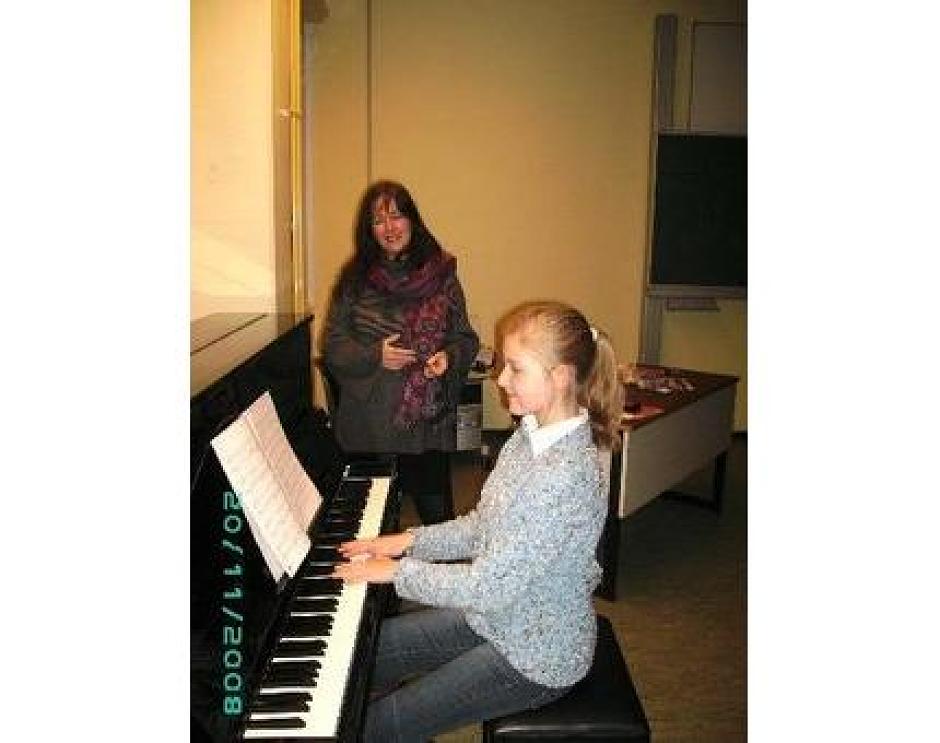Leonie Windeln hat sich mit der Studentin Julia über deren künftigen Beruf als Lehrerein unterhalten.
An vielen Schulen ist Lehrermangel. Du hast Dich entschlossen, Lehrerin zu werden. Warum?
Weil ich denke, dass das ein sinnvoller Beruf ist. Ich erkläre gerne und freue mich wenn der jenige es dann besser versteht.
Welche Fächer wirst Du demnächst unterrichten?
Mathematik und Spanisch.
Gerade Spanischlehrer wollen viele Studenten werden. Kannst Du sagen, warum?
Weil Spanisch eine schöne Sprache ist und immer wichtiger wird. Es ist schließlich die dritthäufigste Sprache auf der Welt. Außerdem ist die Vorstellung an das warme Spanien schön.
Du studierst in Essen. Wie ist denn so die Kursbelegung?
Im Spanischkursus sind momentan 150. Am Anfang waren es doppelt so viele. Im Mathekursus sind es momentan auch ungefähr 150 Leute. Aber das werden bald weniger.
Seit wann wolltest Du Lehrerin werden?
Das erste Mal in der sechsten Klasse. Zwischendurch waren auch mal andere Berufe in Betracht gekommen, aber ich bin immer wieder zurück gekommen.
Was war früher dein Lieblingsfach?
Es war sehr unterschiedlich, meistens Mathe, Geschichte und Spanisch. Aber das hing oft von den Lehrern ab.
Macht es Dir denn immer noch Spaß?
Ja, es ist toll! Ich mache momentan Praktikum, und es macht sehr viel Spaß.
Willst Du denn anders werden als Deine eigenen Lehrer?
Ja, als manche schon. Ich will nach zwei Jahren immer noch engagiert sein. Ich will fair sein, aber trotzdem sagen, wo es lang geht. Natürlich gibt es auch schon heute solche Lehrer.
Leonie Windeln, Düsseldorf, Städt.gymnasium Koblenzer Straße