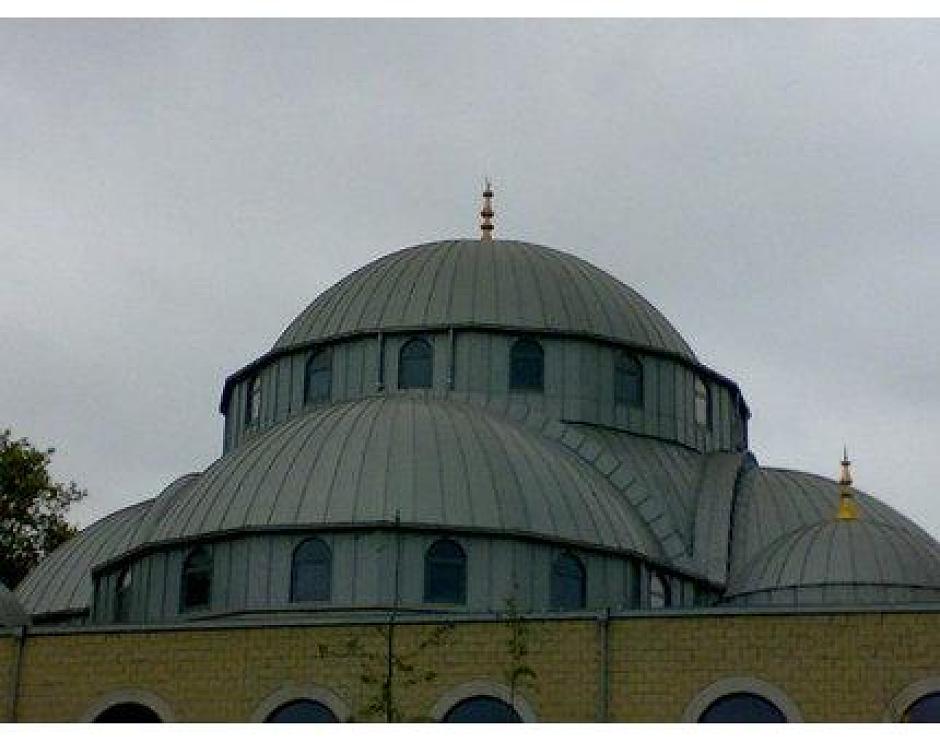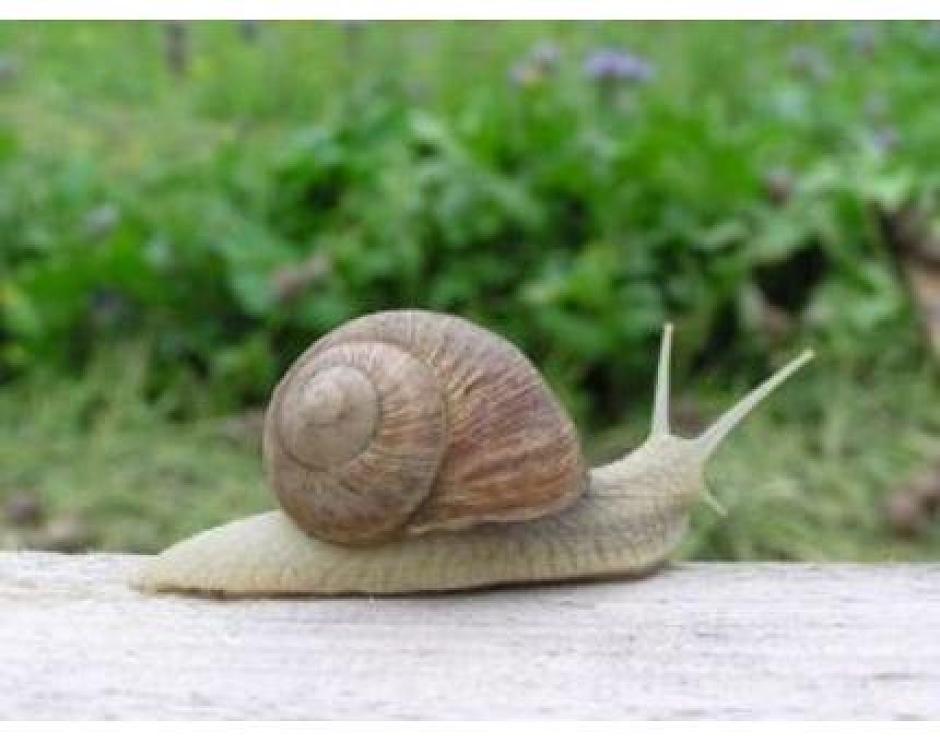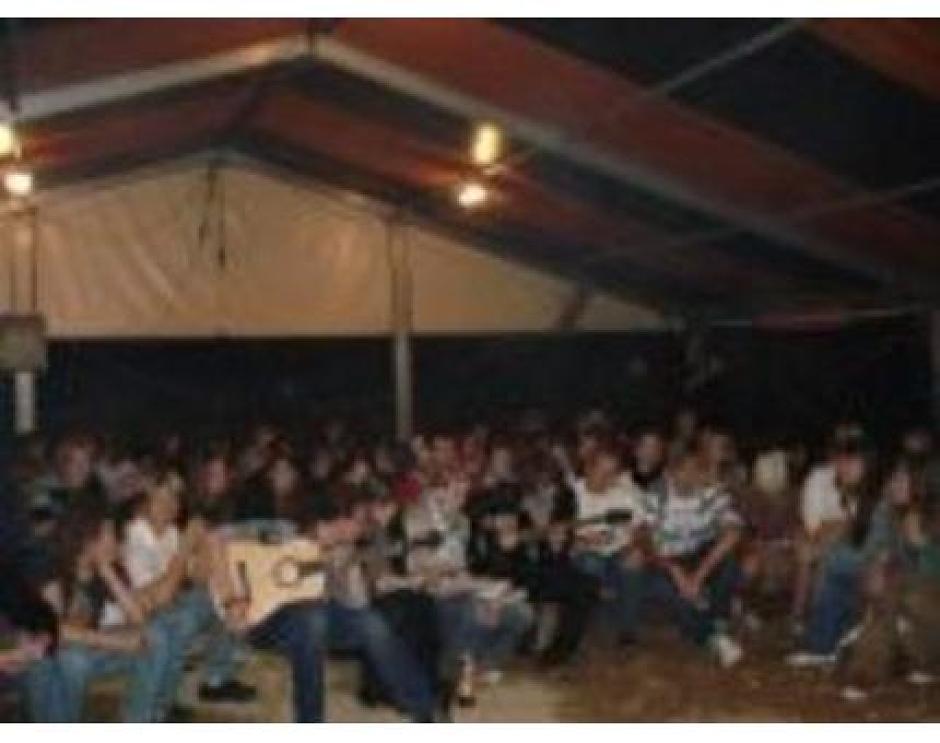„Das kleine Wunder von Marxloh“ wurde die größte Moschee Deutschlands genannt, als sie mit einer großen Feier in Duisburg-Marxloh eingeweiht wurde. Rund drei Millionen Muslime leben zurzeit in Deutschland, davon eine Million in Nordrhein-Westfalen. Inzwischen gibt es 2500 Moscheen in Deutschland, davon ungefähr 150 mit Minarett und Kuppel. Noch steigt ihre Zahl, aber brauchen Muslime in Deutschland wirklich noch mehr Moscheen?
Wir brauchen keine Moscheen, die irgendwo im Verborgenen stehen, sondern, wie es Ministerpräsident Rüttgers betont hat, solche, die sichtbar und erkennbar sind, die nicht nur für Muslime geöffnet sind, sondern für alle.
Aber nicht nur die Türen der Moscheen müssen offen sein, sondern auch die Herzen der Menschen, egal ob Christen, Juden oder anderer Religionszugehörigkeit.
Das ist Integration. Das ist es, was uns zusammenhält. Ein solcher Umgang würde bewirken, dass wir uns nicht als Fremde begegnen, sondern als Freunde.
Moscheen sollten zukünftig noch viel stärker zu Symbolen des Friedens und der Verständigung zwischen den Religionen und den Menschen werden. Die Moschee in Duisburg-Marxloh ist ein gutes Beispiel dafür.
Gebraucht werden Moscheen, die nicht nur für Muslime, sondern für alle offenstehen. So können Orte entstehen, die Raum bieten, um sich gegenseitig kennenzulernen. Im Koran heißt es:
„O ihr Menschen, Wir haben euch von (einem) Mann und (einer) Frau erschaffen und machten euch zu Völkern und Stämmen, damit ihr einander kennet(…).“(49:13)
Ein großer Schritt wird schon gemacht, indem die Imame in Deutschland ausgebildet werden und islamischer Religionsunterricht in deutscher Sprache erteilt wird. Auch das Freitagsgebet wird inzwischen in manchen Moscheen auf Deutsch gehalten. So muss sich keiner ausgeschlossen fühlen, und ein neues Wir-Gefühl kann entstehen.
Ziel muss sein, dass durch neue Moscheebauten, keine Parallelwelten geschaffen werden, sondern Orte, die Zeichen für eine friedliche Welt für alle sind. Für diese gemeinsame Welt müssen Muslime, Christen und andere mit Stolz und Mut eintreten.
Hamide Tuncel, Moers, Anne-Frank-Gesamtschule, Kopernikusstr.