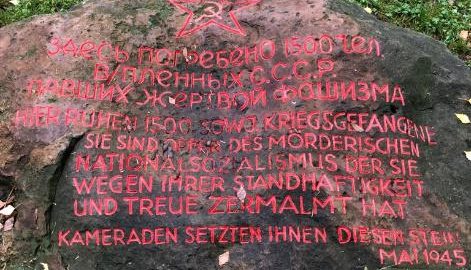Drei Marken bestimmen den Markt für Smartphones. Doch welche ist die Beste?
Von Susanna Alker und Marie Dunker,8e, Gymnasium Korschenbroich
Jeder kennt es. Gedrängel auf den Straßen, mieses Wetter. Das Smartphone ist parat in der Hand, jederzeit griffbereit für ein Foto. Die Kopfhörer stecken im Ohr, niemand hört die dröhnenden Autos neben sich. Und dann, ein geschmücktes Schaufenster, man kommt zum Stehen, zückt sein Handy und mit einem Klick ist das Bild in der Galerie gespeichert.
Allein in Deutschland besitzen rund 57 Millionen Menschen ein Smartphone. Aber die Frage ist: Welche Marke macht hier das Rennen? Apple, Samsung und Huawei sind die bekanntesten und damit auch die beliebtesten Handymarken. Während Apple die Kunden mit besseren Kameras und zusätzlichen Features wie Face ID und langer Akkulaufzeit anlockt, wirbt Samsung mit leistungsstarken Technologie. Huawei wurde durch das gute Preisleistungsverhältnis zum Mitglied der Spitzenreiter, obwohl viele jedoch immer noch mehr auf die Qualität des Smartphones achten, als auf den Preis.
Doch welche Marke ist am geeignetsten für Sie? Kunden werden von Apple vor allem mit der farbgenauen und qualitativ hochwertigen Kamera beeindruckt und zum Kauf des Handys anregt. Auch das Design beeinflusst bei vielen die Kaufentscheidung. Die schimmernden Farben, das große Display und auf der Rückseite der silberne, angebissene Apfel. Doch wegen dem hohen Preis greifen viele Kunden lieber im Regal zu Samsung oder Huawei. Das Galaxy Note 9 und das Huawei Mate 20 sind die Neuesten der Neusten. Zwar besitzt das Note 9 auch einen stolzen Preis von 999 Euro, ist aber immer noch gute 200 Euro günstiger als das iPhone Xs. Den tiefsten Betrag erzielt aber immer noch Huawei mit je nach Angebot rund 550 Euro.
Die Deutschen behalten ihr Smartphone im Schnitt zweieinhalb Jahre, wobei die meisten Apple-Besitzer auch schon vorher ein Smartphone dieser Marke besaßen. Huawei ist hierbei das Küken im Nest. Viele wechselten ihr Handy in den letzten Jahren zu diesem Anbieter, da die Qualität und das Aussehen viel versprechen. Umstritten blieb nur die Kamera, die, wie auch bei Samsung, viele bemängeln. Und dabei legen die meisten Leute viel Wert auf ein gutes Endprodukt beim stetigen Herumgeknipse.
Doch nicht nur Handys werden für Kunden der einzelnen Marke zur Verfügung gestellt. Samsung, Apple und auch Huawei bieten noch viele andere Produkte außer ihren Smartphones an. Apple hat zurzeit ein ganzes Sortiment an verschiedenen technischen Geräten, wie das iPad oder MacBooks auf dem Markt. Doch ist es das wert, noch für weitere Produkte dieser Firma einen stolzen Preis zu zahlen? Die Meinung bleibt gespralten.
Samsung verkauft neben den Smartphones noch Alltagsprodukte. Ob diese Angebote nun wirklich zum Kauf des jeweiligen Handys beitragen, steht in den Sternen. „Apple ist die beliebteste Marke, das ist doch klar!“, meinen Passanten, die wir ansprechen. Aber ob das wirklich stimmt…?