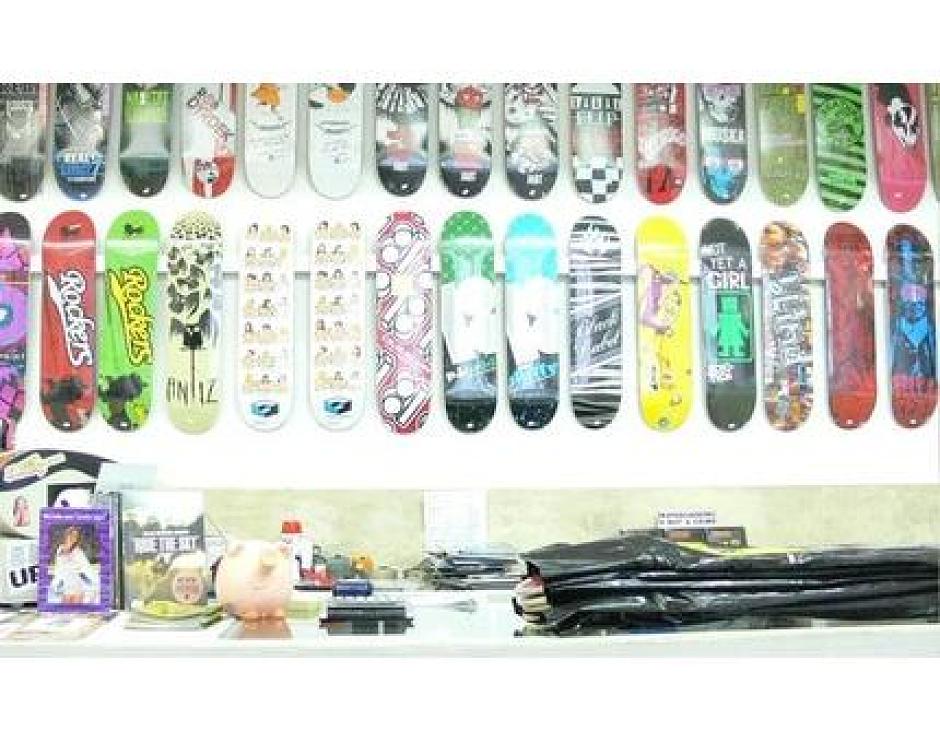Fröhlich kommt Willi, der Australian Shepard, mit seinem Frauchen Silvia B. in der psychiatrischen Klinik an. Sein offizielles Geschirr eines Therapiehundes am Leib, geht er stolz erhobenen Hauptes in den Raum.
Sein heutiger Patient:
ein essgestörtes Kind. Nach dem Beschnuppern und einer kleinen Begrüßung geht es an die Arbeit. „So, dann erzähl mal.“, sagt die Therapeutin. „Es geht einfach nicht, ich kann einfach nichts essen!“, so der etwas schüchterne Heino. Er ist jetzt neun Jahre alt, 1,46 Meter groß und wiegt gerade mal 27 Kilogramm.
Die tiergestützte Therapie wird vor allem bei psychisch gestörten Patienten angewandt. Diese können entweder Essstörungen, ADS, Verfolgungswahn oder Depressionen haben, aber auch traumatisch sein.
Jetzt dürfen sich Willi und Heino mal etwas näher kommen. Dabei muss Heino aber aufpassen, dass der Rüde ihm die Infusionsnadel nicht aus dem Arm reißt. Als Willi dann auf Heinos Schoß sitzt und der Neunjährige ihn streichelt, fragt Silvia B., ob Heino ihm ein paar Leckerlies in Form von Hundeknochen geben möchte. „Au ja!!“. Er nimmt eins und wirft es dem jungen Rüden zu. Der reagiert sofort und frisst das Leckerlie sehr schnell. Da muss Heino lachen. „Darf ich ihm noch eins geben?“, fragt er. „Na klar“, sagt Silvia B. und gibt dem Neunjährigen ein weiteres Leckerlie. Der Hund frisst das Leckerlie mit viel Genuss. Das Ziel dieser Therapie ist, dass sich Heinos Unterbewusstsein wegen des Umgangs mit Essen daran gewöhnt und er wieder anfängt, zu essen. Doch bevor diese Therapie wirken kann, müssen sich Heino und Willi erst noch an einander gewöhnen.
Allgemeinenes:
Die Ausbildung zum Therapiehund erfolgt zwischen den ersten drei bis 12 Wochen im Welpenstadium. Das nennt man die Sozialisierungsphase. Dabei lernt der Hund Gutes mit Schlechtem zu verbinden. Zum Beispiel wird ihm beim Füttern laute Musik vorgespielt. Außerdem ist ein Hund völlig wertfrei. Das heißt, wenn er kommt, will er es auch.
Kinder, die mit Tieren aufwachsen, haben zudem ein besseres Immunsystem.
Das Wichtigste dabei ist jedoch, dass beim Umgang mit Tieren Endorphine ausgeschüttet werden. Dieses Glückshormon hilft zum Beispiel depressiven Kindern zur Heilung.
Maximilian Dewoske, Philip Schütze und Markus Brünner, Mänchengladbach, Franz-Meyers-Gymnasium